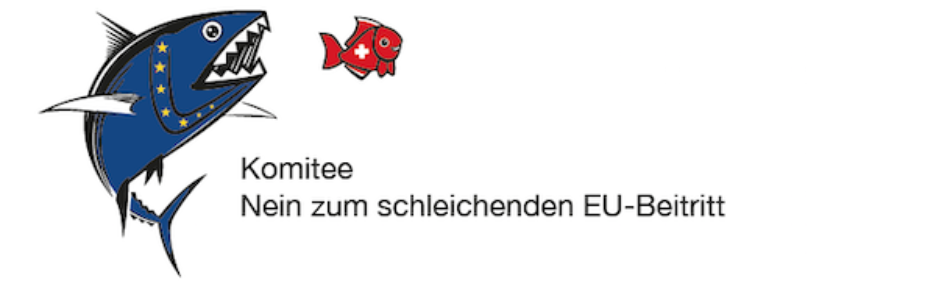Schweiz-EU: Überhastete Verhandlungsführung schadet bloss
Die aus Bundesbern unter Zeitdruck gesetzten Verhandlungen über den Abschluss eines «Rahmenvertrags» mit der Europäischen Union haben zwei profilierte Vertreter der Wirtschaftspublizistik zu einer aufsehenerregenden Stellungnahme zur bundesrätlichen Verhandlungsführung veranlasst.
>> EU-NO Newsletter vom 19. April 2018 im PDF-Dokument herunterladen (hier klicken)
Die Namen der Autoren verleihen der als «Gastkommentar» am 9. April 2018 in der NZZ erschienenen Stellungnahme hohes Gewicht: Gerhard Schwarz, Publizist, war früher Chef der NZZ-Wirtschaftsredaktion und danach Direktor von Avenir Suisse; Rudolf Walser war während vieler Jahre Chefökonom von Economiesuisse.
Die Autoren stören sich zunächst am Begriff der «Roten Linien». Diese sollten nicht mehr überschreitbare Positionen bezüglich Nachgiebigkeit gegenüber der Europäischen Union markieren. Viel wichtiger wäre nach Ansicht der beiden Autoren, dass mit den Verhandlungen erreicht würde, dass beide Vertragspartner einander auf gleicher Augenhöhe respektieren würden. Echter Bilateralismus gedeihe auf uneingeschränkter Souveränität beider Vertragspartner. An «vertraglich klar und fair geregelten Beziehungen mit der EU» habe die Schweiz selbstverständlich eminentes Interesse.
Die Guillotine muss weg!
Wenn der zweifellos stärkere von zwei Vertragspartnern dem kleineren Partner gegenüber eine Guillotine zur Anwendung bringen könne, sei Gleichberechtigung allerdings nicht wirklich gewährleistet. Die Gesetzgebungskompetenz, wie sie in der Verfassung der souveränen Schweiz verankert sei, werde durch die existierende Guillotine-Klausel verletzt. Diese sei «eines partnerschaftlichen Verhältnisses unwürdig», müsse also endlich beseitigt werden – auch wenn diese Klausel, wie die Autoren zu erwähnen nicht vergessen, seinerzeit «von übereifrigen Schweizer Diplomaten vorgeschlagen worden sein» soll.
Als «Rote Linie» keinesfalls Preiszugebendes markierend, versteht der Bundesrat einerseits die «flankierenden Massnahmen», anderseits die Ablehnung der «Unionsbürgerschaft». Gerhard Schwarz und Rudolf Walser bezweifeln, ob damit die richtigen Schwerpunkte gesetzt würden. Im Bekenntnis zu den flankierenden Massnahmen sehen sie eher einen – innenpolitisch motivierten – bundesrätlichen Kotau vor den Gewerkschaften. Und das Nein zur Übernahme des EU-Bürgerrechts für die Schweiz beantworten sie mit Kopfschütteln: Für ein erklärtes Nicht-Mitglied der EU stehe die Unionsbürgerschaft doch von vorneherein ausserhalb jeder ernstzunehmenden Diskussion.
Viel wichtiger sei, dass die Schweiz trotz Rahmenvertrag ihre in der Verfassung verankerte Form der Schaffung hier gültigen Rechts bewahre – nach föderalistischer Überzeugung von unten nach oben. Mittels «dynamischer Rechtsübernahme» von EU-Beschlüssen sowie durch die Unterstellung der Schweiz unter die Oberhoheit des EU-Gerichtshofs würde dies zumindest teilweise verunmöglicht – womit die Schweiz der EU nicht mehr als souveräner Staat und somit als gleichberechtigte Vertragspartnerin auf gleicher Augenhöhe gegenüberstehe. Es müsse ihr eine «Opting-out-Klausel» gewährleistet werden, also die Freiheit, eine von der EU getroffene, für die Schweiz offensichtlich unvorteilhafte Neuerung nicht nachvollziehen zu müssen.
Schiedsgericht – echt oder unecht?
Dazu werde jetzt zwar eine Schiedsgerichts-Lösung anvisiert anstelle der direkten Unterstellung der Schweiz unter den EU-Gerichtshof.
Dass der Bundesrat die Unzumutbarkeit solcher Direktunterstellung erkenne, sei zwar positiv. Doch jenes Organ, das jetzt als «Schiedsgericht» in die Diskussion eingeführt werde, sei nur dann akzeptabel, wenn es tatsächlich als unabhängiges Organ wirken könne. Diese Unabhängigkeit müsste von beiden Seiten zweifelsfrei gewährleistet werden. Wenn die EU dieses Schiedsgericht bloss als ein dem EU-Gerichtshof vorgelagertes Organ betrachte, über dessen Entscheide dem EU-Gerichtshof das letzte Wort vorbehalten bleibe, könne von Unabhängigkeit, also von echtem Schiedsgericht keine Rede sein.
Ein echtes Schiedsgericht müsse von beiden daran paritätisch beteiligten, völkerrechtlich gleichwertigen Parteien ausdrücklich als unabhängig anerkannt werden – zuständig für alle Streitfälle, die zwischen den beiden Vertragspartnern auftreten können. Es müsste abschliessend entscheiden können. Und die von ihm zuwege gebrachten Beschlüsse müssten von beiden Seiten akzeptiert werden.
Bleibe das Schiedsgericht der Oberhoheit des EU-Gerichtshofs unterstellt, sei es bloss Aushängeschild eines Etikettenschwindels. Werde dieses Schiedsgericht gleich wie der EU-Gerichtshof der von Brüssel ausgehenden Devise unterstellt, mit seinen Entscheiden stets «dem immer engeren Zusammenschluss» der EU dienen zu müssen, dann könne von echtem Schiedsgericht keine Rede sein.
Gegenüber einem dem EU-Gerichtshof unterstellten Schiedsgericht bleibe die Schweiz dem von der EU gekonnt beherrschten Doppelspiel ausgesetzt, wonach sie ganz nach Belieben Brüssels zuweilen als «Binnenmarktteilnehmer», mitunter aber auch bloss als «bilateraler Partner» beurteilt und bewertet werde – wie das Brüssel im Einzelfall diene.
Die flankierenden Massnahmen
Die «flankierenden Massnahmen» als unantastbar zu bezeichnen, erachten Gerhard Schwarz und Rudolf Walser als bundesrätlichen Fehler. Einerseits würden diese politisch hochgelobten Massnahmen lediglich dem Bau- und dem Ausbaugewerbe gewissen Teilschutz gewähren.
Insgesamt erwüchsen der Schweizer Wirtschaft daraus aber Nachteile, die ihre Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene entscheidend beeinträchtigten: Die faktischen Mindestlohn-Regelungen seien für Berufseinsteiger, Niedrigqualifizierte und ältere Arbeitnehmer diskriminierend, da sie damit «der globalen Konkurrenz schutzlos ausgesetzt» seien. Die Schweizer Wirtschaft könne im internationalen Wettbewerb nur dank flexiblem Arbeitsmarkt und liberaler Wirtschaftsordnung Schritt halten.
Keine Überhastung!
Der NZZ-Gastkommentar von Gerhard Schwarz und Rudolf Walser schliesst mit einer nachdrücklichen Warnung an den Bundesrat vor der «schwer verständlichen Hast», welche die gegenwärtige Verhandlungsführung präge. Diese einem Zieldatum zu unterstellen, sei falsch. Wer die eigene Seite zur Eile antreibe, trage Mitschuld an vorschneller Kompromissbereitschaft zum Nachteil der Schweizer Verhandlungsposition.
Die heutige Vertragsbasis gestatte der Schweiz einen jährlichen Handelsaustausch mit der EU im Volumen von rund 240 Milliarden Franken (2016), welcher «so gut wie friktionslos abgewickelt» werde. Damit bestehe keine Veranlassung, gute Resultate durch überstürzte Verhandlungsführung zu verspielen. Von Seiten der europäischen und der schweizerischen Wirtschaft sei nie ein Bedürfnis nach einem institutionellen Rahmenabkommen geäussert worden (Randbemerkung der Redaktion: Ein kaum überhörbarer Seitenhieb in Richtung Economiesuisse, die sich immer einseitiger als Interessenvertreterin ausländischer Manager an der Spitze internationaler Konzerne aufspielt).
Die Schikanierung der Schweizer Börsen sei ein «unfreundlicher Akt der EU» und lasse es als geraten erscheinen, dem EU-Druck auf raschen Verhandlungsabschluss nicht nachzugeben. Offensichtlich sei, dass das Nicht-Abwarten des Abschlusses der Brexit-Verhandlungen zwischen Brüssel und London der Schweiz nur zum Nachteil gereichen könne: Die EU kann der Schweiz nirgends entgegenkommen, wenn sie davon ausgehen müsse, dass jegliche Kompromissbereitschaft gegenüber der Schweiz sofort entsprechende Forderungen aus London an Brüssel auslösen würde. Solange die Brexit-Verhandlungen andauern, müsse sich die EU der Schweiz gegenüber zwangsläufig kleinlich verhalten.
Ohne die osteuropäischen Staaten namentlich zu nennen, gehen die Autoren des NZZ-Gastkommentars davon aus, dass deren Forderungen auf grössere Entscheidungsfreiheit der einzelnen EU-Mitgliedstaaten nicht resultatlos bleiben werden – woraus die Schweiz Vorteile ziehen könnte.
Ein Verhältnis ohne Guillotine in der Hand Brüssels anstrebend, schliessen Gerhard Schwarz und Rudolf Walser mit folgendem Appell an den Bundesrat als Voraussetzung für erfolgversprechende Verhandlungsführung:
«Dafür darf man sich ruhig Zeit nehmen. Hingegen wäre eine schnelle Lösung, die ungleichgewichtig wäre und einen Etikettenschwindel darstellte, wirklich eine «rote Linie» – für alle Liberalen genauso wie für alle, die das politische System der Schweiz bei aller Reformbedürftigkeit doch für weniger schlecht halten als das der europäischen Partner und der EU.»
EU-No/us
Eigentlich hätten wir es vorgezogen, den Lesern des EU-No-Bulletins anstelle der hier übermittelten Zusammenfassung den Originaltext des am 9. April 2018 in der NZZ erschienenen Gastkommentars unter dem Titel «Vergessene rote Linien» von Gerhard Schwarz und Rudolf Walser zuzustellen. Bedauerlicherweise hat die NZZ-Redaktion unserem Komitee das Copyright für den Nachdruck dieses Artikels verweigert.