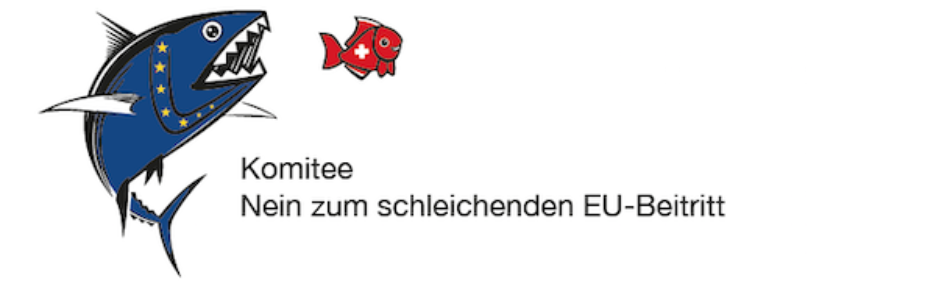Mit der EU verhandeln heisst: Die Interessen der Schweiz verteidigen. Oder? So klar ist das nicht.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Problem und nehmen einen Anwalt, der für Sie mit der Gegenseite verhandeln soll. Die Gegenseite ist kein Feind, aber ein Gegner, vor allem hat er, sonst gäbe es ja keinen Konflikt, andere Interessen, eine andere Sicht der Dinge, und auch er möchte wie Sie selbst: gewinnen.
EU-NO Newsletter
von Markus Somm, Chefredaktor Basler Zeitung
Sie reden lange mit Ihrem Anwalt, er gibt vor, nachvollziehen zu können, was Sie wünschen, und macht sich ein paar Notizen. Er hat, so macht es den Anschein, gut zugehört. Er hat verstanden. Also zieht er los und setzt sich mit dem Anwalt der Gegenseite zusammen: Wir haben dieses Anliegen, wir möchten verhandeln.
Erstaunlicherweise, man kann es kaum glauben, sagt der Anwalt der Gegenseite: Wir sehen es anders. Wir möchten nicht. Was macht Ihr Anwalt nun, dessen ebenso erstaunliche Honorarnoten Sie immer pünktlich zu begleichen pflegten? Er nickt und kommt zu Ihnen zurück. Dann sagt er Ihnen: Die Gegenseite will nicht. Also können wir nichts machen. Und das war das Ende der Verhandlungen. Sie haben verloren.
Würden Sie einem solchen Anwalt vertrauen? Oder ihm nicht sogleich das Mandat entziehen? Die Fragen stellen heisst, sie beantworten.
Bevor der Nationalrat vor kurzem die Verfassung brach, indem eine Mehrheit der Volksvertreter so tat, als ob sie die Masseneinwanderungs-Initiative umsetzen würde, liess eine panische, offizielle Schweiz in Brüssel nachfragen, ob er denn recht sei, dieser «Inländervorrang light», den man im Begriff war zu beschliessen, womit man das ignorierte, was Volk und Stände vor fast drei Jahren in die Verfassung geschrieben hatten. Die Damen und Herren in Brüssel dachten lange nach, wogen alle Argumente ab, machten sich Notizen, gingen in sich, brüteten und sagten: Mmmh, es passt noch nicht ganz, wahrscheinlich. Und die offizielle Schweiz wäre fast gestorben vor Angst und Schrecken. Sicher könnte man noch ein bisschen nachbessern, nicht wahr? Fragen Sie die FDP.
Sehnsucht nach Brüssel
Seit Jahren haben wir Diplomaten angestellt, die – dieses Eindrucks kann man sich nicht länger erwehren – genauso verhandeln. Sie fliegen nach Brüssel und teilen dort der Gegenseite mit: Unser Auftraggeber, unser Souverän, will das und das. Brüssel brütet und sagt: Wir wollen das nicht. Nach dieser brutalen Auseinandersetzung kehren unsere tapferen Diplomaten in die Zentrale zurück und melden: Brüssel will nicht. Also können wir nichts machen.
Nun ist es ja nicht so, dass ich das alles erfinde. Enge Vertraute einflussreicher Bundesräte (die nicht der SVP angehören) erzählen hinter vorgehaltener Hand die Geschichte nicht anders: Als es darum ging, in Brüssel für eine Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit zu werben, hätten die Schweizer Diplomaten Anfängerfehler gemacht, wie das nur selten zu beobachten sei. Insbesondere gaben sie Brüssel immer zu verstehen, dass sie keinesfalls bereit wären, vom Tisch aufzustehen und die Kündigung der Bilateralen in Kauf zu nehmen. Ein Grundsatz aus dem ABC der Verhandlungskunst, keine Erkenntnis aus der Kernphysik: Verbirg deine Absichten! Tu so, als könntest du jederzeit wieder gehen. Insgeheim verstanden «unsere» Vertreter die Position von Brüssel besser als jene ihres eigenen Chefs in der Heimat – und zeigten das dem «Gegner» auch. Man fragt sich, warum sie sich nicht direkt von der EU anstellen lassen? Das wäre transparenter. Mit anderen Worten, sie blufften nie, sondern sassen da wie unschuldige Engel, die an das Gute im Menschen glauben. Sie verhielten sich naiv auf eine Art und Weise, die wohl nicht fahrlässig war, sondern mutwillig.
Diese Diplomaten, die in ihrer Mehrheit einmal in ihrer Karriere, meistens noch heute, glaubten, dass die Schweiz eigentlich der EU beitreten sollte: Diese Diplomaten vertraten unser Land nicht.
Die gleichen Vertrauten, die das Ohr von Bundesräten haben, sagen: Es sei völlig undenkbar, dass die EU je die bilateralen Abkommen kündigen würde. Denn 28, in Worten: achtundzwanzig Mitgliedstaaten müssten je einzeln diesen Schritt tun. Und weil diese Vertrauten den Bundesräten sehr nahe stehen, wissen wir, dass auch unsere Regierung das weiss.
Chefunterhändler für wen?
Wie unsere Diplomatie vorgibt, für die Schweiz einzutreten, während sie längst auf die Gegenseite gewechselt hat, demonstrierte am 30. September 2016 Jacques de Watteville, der aktuelle Chefunterhändler mit der EU. Auf die Frage des Tages-Anzeigers, warum die Schweiz nach wie vor über ein institutionelles Rahmenabkommen verhandle – angesichts der Tatsache, dass ein solches derzeit innenpolitisch keine Chance habe –, sagte de Watteville:
«Die Schweiz braucht Rechtssicherheit und Marktzugang. Die EU-Regeln entwickeln sich laufend. Damit unsere Unternehmen weiterhin ohne Hindernisse in die EU exportieren können, müssen wir die Verträge den aktuellen Bestimmungen anpassen. Dafür brauchen wir ein Abkommen, das der Rechtsentwicklung auf dynamische Weise Rechnung trägt. Hinzu kommt, dass wir heute nicht in allen Bereichen Marktzugang haben.»
Besser hätte ein Diplomat der EU die Wünsche und Sicht der EU nicht ausdrücken können. De Watteville tarnt das, indem er von der Schweiz spricht, als ob sie auf ein Rahmenabkommen angewiesen wäre – dabei drängt die EU darauf – nicht wir. De Watteville stellt die Lage auf den Kopf. Er verwirrt und vernebelt seinen Chef, den Schweizer Bürger, der seine Aussagen liest. Am Ende glaubt der Leser, er müsste dankbar sein, dass die EU uns ein Rahmenabkommen gewährt.
Was uns stört und das Abkommen innenpolitisch kaum mehrheitsfähig macht, ist gerade die sogenannte «dynamische» Übernahme der EU-Regeln, was ein hübsches Wort ist für: Unterwerfung. De Watteville, der elegante Wortakrobat, tut so, als ob wir davon profitieren könnten, dabei ist das Gegenteil der Fall. Das liegt nie und nimmer in unserem Interesse, sondern entspricht demjenigen der EU. Unbehelligt will sie die Regeln ändern, auf die wir uns gemeinsam in Verträgen geeinigt haben. Wir dagegen haben dieses Recht natürlich nicht.
Die EU ist der Vermieter, der einen Mietvertrag jeden Tag umschreibt, ohne dass wir Mieter je dazu befragt werden müssten: Einmal steigt die Miete, dann zieht die Schwiegermutter des Vermieters ein, schliesslich wird der Schlüssel ausgewechselt und der Mieter schläft im Gartenhaus.
Die EU will alle Regeln und Gesetze, die den Binnenmarkt betreffen, «weiterentwickeln» können, ohne dass die Schweiz, ihre Regierung, ihr Parlament und vor allem ihr Souverän je noch etwas dazu zu sagen hätten. Passt es? Diese Frage müssten wir gar nie mehr stellen, wenn wir unsere Gesetze den Brüsseler Eurokraten zuliebe anpassen. Wir müssen dann einfach. Ja, wir freuen uns darauf.
Diesen Eindruck erweckt unser Chefunterhändler, wenn er so in der Öffentlichkeit redet, wenn er der EU so deutlich verrät, auf welcher Seite er gerne stünde, wessen Anliegen er wirklich versteht. Wer so verhandelt, will nichts erreichen. Er scheitert mit Begeisterung. Deshalb haben wir seit fast drei Jahren kein Ergebnis erreicht in Brüssel. De Watteville ist ein Anwalt, der pro bono für die Gegenseite arbeitet. Es ist Zeit, den Anwalt auszuwechseln.
E-Mail: markus.somm@baz.ch
Erstabdruck: Basler Zeitung, 1. Oktober 2016