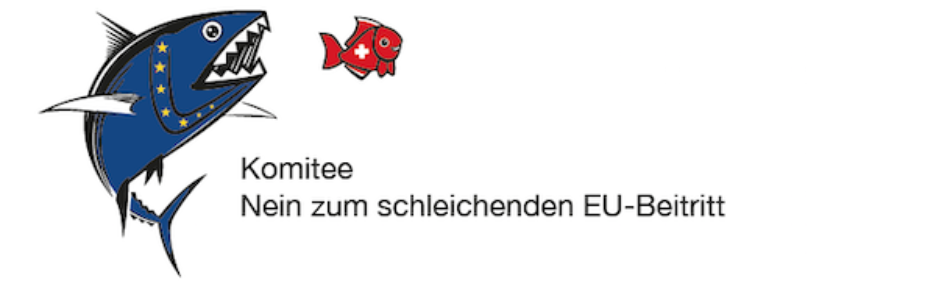Neue Wirtschaftsturbulenzen wegen Einheitswährung
Es war eine schöne Illusion: Man flutet die Märkte mit Liquidität und schon kann die europäische Schuldenorgie munter weitergehen. Doch nun kehrt die Euro-Krise zurück. Und sie könnte noch gefährlicher sein als alles, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben.
EU-NO Bulletin vom 20. November 2014
Die derzeitige Situation birgt viel Brisanz. Möglicherweise hat der britische Banker Andrew Roberts von der Royal Bank of Scotland dieser Tage die Lage sehr treffend beschrieben, als er feststellte: «Das Ende des Spiels steht bevor». Und die Konsequenzen könnten zu schrecklich sein, um darüber nachzudenken. Jetzt dürften sich schon bald die zerstörerischen Folgen des Liquiditäts-Tsunamis zeigen, mit dem die Europäische Zentralbank (EZB) vorübergehend die Symptome der Euro-Krise zu bekämpfen suchte und gleichzeitig gefährliche Preisblasen vor allem auf dem deutschen Immobilienmarkt, aber auch an den Aktienmärkten entstehen liess.
Die Zeche für Sparzinsen nahe der Nulllinie zahlen vor allem die Deutschen und Österreicher. Wie aus dem im September vorgestellten Global Wealth Report hervorgeht, hat die Niedrigzinspolitik der EZB die Privathaushalte in Deutschland seit 2010 rund 23 Milliarden Euro gekostet. Die Spanier hingegen wurden um 54 Milliarden Euro entlastet, die Italiener um 39 Milliarden. Profitiert haben also die Schuldenmacher.
Gefangen in der Sackgasse
Nun aber hat die EZB nicht nur ihr Pulver verschossen, sondern zudem die Euro-Zone in eine gefährliche Sackgasse manövriert. Der Wert des Euro, der im Frühjahr noch bei 1,40 US-Dollar lag, fällt dramatisch. Mitte Oktober notierte er bei 1,27 Dollar. Wirklich besorgniserregend ist aber der Ausblick: Der Euro könnte bis Ende 2017 auf gerade einmal 95 US-Cent fallen, sagt George Saravelos voraus. Der Währungsstratege der Deutschen Bank gehört in dieser Frage zwar zu den Pessimisten, aber auch andere Experten gehen von einer weiteren Schwächung der europäischen Gemeinschaftswährung aus. Die Prognosen liegen auf mittlere Sicht zwischen einem und 1,18 US-Dollar. Der Grund für die anhaltende Euro-Schwäche ist schnell ausgemacht:
Da ist zum einen die schlechte Konjunkturlage in vielen Staaten der Euro-Zone sowie die nach wie vor schwelende Schuldenkrise. Nun verdüstern sich sogar die Konjunkturaussichten für das bisher so stabil geglaubte Deutschland. Immerhin wurden die Wachstumsprognosen drastisch nach unten korrigiert. Vor allem aber setzen die Märkte auf eine baldige Zinsanhebung in den USA, während die EZB ihre Politik des extrem billigen Geldes wahrscheinlich noch jahrelang fortsetzen dürfte. Zudem pumpt Draghi immer mehr Geld in die Märkte, indem er auf dem Kapitalmarkt Anleihen kauft.
Steigende Staatsverschuldung
Selbst wenn die EZB wollte, könnte sie die Zinsen kurz- bis mittelfristig nicht erhöhen, denn das hätte dramatische Folgen für die immer noch hochverschuldeten Südstaaten der Euro-Zone. Deren Probleme sind alles andere als gelöst. Im Gegenteil: Der in Brüssel so beliebte italienische Ministerpräsident Matteo Renzi, den kritische Medien längst als «Ankündigungsweltmeister» verspotten, stellte gerade ein 36 Milliarden-Euro-Konjunkturpaket in Aussicht. Dabei macht die Staatsverschuldung des Apenninenstaates schon jetzt fast 133 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Sie könnte in den nächsten Jahren auf 150 Prozent anwachsen. Renzi spielt Vabanque. Springt die Konjunktur nicht an, dann droht die Verschuldung des Landes beinahe schon griechische Verhältnisse zu erreichen.
Die französische Staatsverschuldung wiederum sehen kritische Experten innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 120 Prozent des BIP steigen. Wenn in dieser Situation die Zinsen angehoben würden, wäre die Währungsunion zumindest in ihrer derzeitigen Form wohl am Ende. Kein «Rettungsschirm» wäre gross genug, um Nationen wie Frankreich oder Italien aufzufangen.
Darüber hinaus kursierten in den vergangenen Tagen Gerüchte, wonach auch griechische Banken erneut von der EZB gerettet werden mussten. Die offizielle Lesart lautet, die EZB habe griechischen Banken «den Zugang zu frischem Geld erleichtert». Insider scheinen derweil schon mit dem Schlimmsten zu rechnen. Im vergangenen August und September flossen 76 Milliarden Euro aus Italien ab. Und nicht nur das: Der steigende Dollarkurs macht deutlich, dass offenkundig auch viel Geld aus der Euro-Zone in die USA fliesst. Extrem niedrige Zinsen und eine schwache Konjunktur machen die meisten Euro-Länder für Investitionen unattraktiv.
Dieser Beitrag ist aus dem «Ulfkotte-Newsletter» Nr. 212 entnommen.